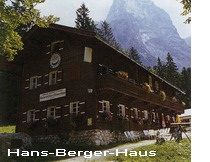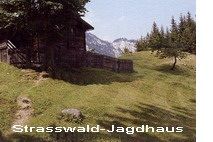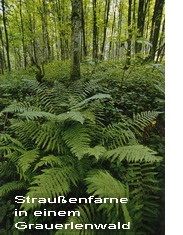- Willkommen im Forum „roBerge.de“.
[ hier mehr Touren-Tipps ]
roBerge.de
Ins Kaisertal
Wanderung durchs schöne Abseits
Im Tal der Gesetzlosen
Wilde Gipfel, dem Himmel ganz nah, entrückte Maßstäbe, unnahbarer Fels und gangbar gemachte Täler - der Wilde Kaiser, ein Paradies zwischen Kletterrouten und der Sanftheit der umgebenden Landschaft.
Einst wurde es das Tal der Gesetzlosen genannt, weil es nicht über eine Straße zugänglich gemacht wurde. Wer früher gern frei denken und wild leben wollte, kam oder siedelte ins Tal. Biedermänner, Aussteiger, Bergfexe, alle fanden ihre Lust und ihre Grenzen im Kaisertal. Hier konnte glücklich werden, wessen Herz nicht an Regeln hing. So fahren hier noch heute Autos ohne Nummerntafeln, die mühevoll mit der Seilwinde die hunderten Stufen hinauf gezerrt wurden. Doch dies wird sich bald ändern, denn die Zufahrtsstraße als jahrzehntelanger Zankapfel zwischen Gemeinden, Bewohnern und Behörden ist längst Projekt und soll gebaut werden. Das Tal der Gesetzlosen erhält Anschluss an die Außenwelt.
Noch immer dient das Kaisertal 30 Menschen als Heimat. Sie bestellen die Felder, mähen die Steilhänge oder schaffen das Holz Stamm für Stamm mit der Seilwinde aus dem Tal. 200 schwitzende Stufen dauert der Aufstieg über den Felsriegel in den sich der Bach nach den Eiszeiten in erdgeschichtlich rasender Geschwindigkeit eingeschnitten hat. So rasch, dass kein Platz für eine Straße blieb. Das Kaisertal ist nämlich ein so genanntes Hängetal, das von einem Gletscher trogförmig ausgeschürft wurde. In einer Wärmeperiode gerieten die Gletscher jedoch in Stillstand und konnten das Tal nicht mehr bis an die Basis des Inntals ausschürfen. Nach den Eiszeiten hat sich der Kaiserbach rasch in das weiche, leicht erodierbare Kalkgestein eingeschnitten und die tiefe, unzugängliche Schlucht erzeugt. So verhindert nach wie vor ein 150 m hoher Felsriegel den Zugang zum modernen Leben. Am Pfandlhof endet die Materialseilbahn, die als Lebensader das Tal mit allem Notwendigen beliefert, aber auch die Ernten nach Kufstein bringt.
Das etwa 15 km lange Kaisertal führt von Kufstein aus mitten ins Kaisergebirge, von dessen Gipfeln es zu allen Seiten eingeschlossen wird. Es handelt sich dabei um zwei parallel, in westöstlicher Richtung verlaufende Kämme. Während der südliche Wilder Kaiser genannt wird und mit der Ellmauer Halt (2344 m) den höchsten Gipfel aufweist, trägt der nördliche Teil den Namen Zahmer Kaiser. Seine Gipfel ragen bis knapp über 2000 m empor und erreichen ihre höchste Erhebung in der Vorderen Kesselschneid mit 2002 m. Beide Gebirgszüge stoßen am Stripsenjoch aufeinander. Die erste Gipfelbesteigung erfolgte vermutlich um 1794. Seit dem 29. April 1963 steht das gesamte Gebirge als Naturschutzgebiet mit einer Gesamtfläche von 10,2 km' unter Schutz.
Das Kaisergebirge lässt sich als Miniatur-Hochgebirge mit 41 selbstständigen Berggipfeln beschreiben. Der Name dürfte mindestens 750 Jahre alt sein und taucht 1222 bei einem Jahreszinsvermerk eines bayerischen Buchhalters erstmals auf. Vor 230 Millionen Jahren lagerten unzählige Kalk absondernde Algen in einem tropischen Urmeer der mittleren Trias die Bausteine für dieses Gebirge ab, die sich zu gewaltigen Kalksteinpaketen zusammen geschoben haben. Da der Hochkaiser eine aus Wettersteinkalk und jüngeren Schichten gefüllte Mulde darstellt, fallen die Schichten rund um Totenkirchl, Predigtstuhl und Fleischbank steil ein.
Die Wettersteinkalkbänke treten dann im Zahmen Kaiser wieder auf. Sie sind hier jedoch flacher gelagert und bilden ein Plateau. Der Einschnitt dazwischen besteht aus Hauptdolomit und bildet die Basis für das Kaisertal. Der im Süden vorgelagerte Niederkaiser wird aus Buntsandstein aufgebaut. Während der Eiszeiten umschlossen zwei mächtige Eisströme, der Inntal- und der Kitzbüheler-Ache-Gletscher, den Gebirgsstock. Man muss sich eine weite Eisfläche vorstellen, die vom Kitzbüheler Horn bis zum Rofan reichte und nur die Gipfelflur des Kaisers freigab, die höher als 1900 m war. Denn bis dorthin sind die Schliffspuren erkennbar. Mit dem Beginn der Warmzeit sind die Eismassen abgeschmolzen und haben die heutigen Tal-, Hang- und Gratformen hinterlassen.
- Region:
- Kaisergebirge
- Tourenart:
-
Bergtour
- Erreichte Gipfel:
- Gamskogel 1440 m
- Dauer:
- 6 Std.
- Einkehrmöglichkeiten:
- Touristinfo:
-
Kufstein
- Höhenunterschied:
- 950 m
- Streckenlänge:
- 15 km
- Schwierigkeit:
-
mittel (mehr Info)
Mittelschwere Rundwanderung auf durchwegs bequemen und gut ausgebauten Bergpfaden sowie Forststraßen, lediglich der Abstieg über den Bettlersteig, der steil ist und kleinere Passagen mit Seilsicherung und Leitern beinhaltt, erschwert die Route; es gibt jedoch keinerlei ausgesetzte Stellen oder Klettereien. durchgehend markiert und mit Wegweisern beschildert - Hunde:
- für Hunde geeignet.
Hinweise für Hundebesitzer: Vorsicht beim Betreten von Almgeländen und Weideflächen - Muttertiere schützen ihre Kälber, deshalb Hunde anleinen und Distanz halten, es besteht auch Gefahr für den Hundebesitzer. Bei Gefahr Leine loslassen. Flüchtendes Wild löst auch bei ansonsten friedlichen Hunden den Jagdinstinkt aus und kann zum Verletzen oder Reißen führen. Im Extremfall sind Jäger berechtigt, frei laufende und wildernde Hunde zu erschießen. Bitte die Hinterlassenschaften in Kotbeutel entsorgen und den Beutel ins Tal mitnehmen.
Kufstein-Kaiserlift 508 m
GPS-Wegpunkt:
N47 35.408 E12 11.142 zu Google Maps
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn bis nach Kufstein fahren. Dann zu Fuß in nordöstlicher Richtung (40 Minuten vom Bahnhof) oder mit dem Postbus.
Mit dem Pkw:
In Kufstein an der Talstation des Kaiser-Sessellifts. Autobahnausfahrt Kufstein-Nord, von dort in die Stadtmitte und der Beschilderung folgen.
Weinbergerhaus/Brentenjoch:
Wer (als Wanderer) nicht die Aufstiegshilfe (Sessellift) benutzen will, muss mit einer zusätzlichen Aufstiegszeit von ca. 1,5 - 2 Stunden rechnen. Fahrtbeginn erst ab 9 Uhr. Höhe: Tal 510 m, Brentenjoch 1204 m. Wichtig: Der Kaiserlift ist im Winter geschlossen, auch an den Wochenenden.
- Ab Rosenheim: 40 Km / 0:35 Std
- Ab München: 90 Km / 1:00 Std
- Ab Bad Tölz: 75 Km / 1:00 Std
- Ab Salzburg: 110 Km / 1:05 Std
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
hier klicken
Zum Zoomen der Karte bitte STRG und Mausrad benutzen.
Die Wanderung beginnt am Brentenjoch (1273 m), das man bequem mit dem Kaiserlift in zwei Sektionen mit Mittelstation an der Duxer Alm erreicht. Damit spart man sich einen längeren Aufstieg entlang von Forstwegen. Vom Brentenjoch, in dessen Nähe sich das Weinberger Haus befindet, wandern wir zuerst an der Nordseite um die bewaldete Kuppe herum und folgen dann dem Weg hinab zur Almhütte Brentenjoch. Hier gabeln sich die Wege, wobei wir dem links abgehenden Waldsteig in Richtung Gamskogel folgen (Weg Nr.4). Durch montanen Berg-Mischwald geht es auf dem gut ausgetretenen Steig in etwa 45 Minuten zum Gamskogel.
1. Die Besonderheit der Vegetation am Brentenjoch und am nachfolgenden bewaldeten Grat bis zum Gamskogel ist das Vorkommen der Schneerose. Damit erreichten sie hier ihren westlichsten Standort innerhalb der Nördlichen Kalkalpen. Im Frühjahr sind die Hänge gleich nach der Schneeschmelze vom leuchtenden Weiß der Schneerose erfüllt, dazwischen bereichert das Rot des Seidelbasts die Blütenpracht, der seine purpurnen Blüten vor den Blättern erscheinen lässt.
Es wird in Zusammenhang mit der Schneerose ein eigener Mischwaldtyp beschrieben, der von Buchen, Tannen und Fichten dominiert wird. In der Krautschicht bilden die Schneerosen, die knapp nach der Schneeschmelze blühen, einen auffälligen Unterwuchs. Diese dekorative Pflanze nimmt wasserzügige, steile Hänge über Kalkgestein in der montanen Stufe ein. Je tiefer dieser Waldtyp steigt, umso mehr nimmt die Buche überhand. Neben der Schneerose treffen wir charakteristische Arten der Kalkbuchenwälder wie Ringelkraut, Leberblümchen, Goldnessel, Ochsenauge, Fuchs' Knabenkraut, Schwarze Akelei oder Nickendes Perlgras an. Da an wasserzügigen Hängen auch gerne Hochstauden vorkommen, wachsen in Mulden und Rinnen Gelber Eisenhut, Wald-Greiskraut und Trollblume.
2. Der letzte Teil des Aufstiegsweges zum Gamskogel führt immer wieder durch lichte Mulden und bereits durch niedriger werdenden Wald, und bald nehmen die Legföhrenfluren zu. Weiterhin begleiten uns jedoch die auffällig gefingerten dunkelgrünen Blätter der Schneerose, ehe wir den stillen, abgeflachten Gipfel des Gamskogels erreichen, der einen herrlichen Blick ins Kaisertal sowie auf die Nordabbrüche des Wilden Kaisers erlaubt. Der Abstieg nach Süden führt entlang eines Grates zuerst in eine bewaldete Senke, dann durch Hochwald in die Wiesenhänge oberhalb des Steinberg Hauses.
3. Nach dem Gamskogel wandern wir entlang eines Grates, der mit Legföhrenfluren bewachsen ist. Der Weg schneidet sich durch die dichten Gebüsche, wird von Ochsenauge und Berg-Baldrian gesäumt und gibt einen herrlichen Blick auf die aus Wettersteinkalk aufgebauten Wände des Scheffauers (2111 m) frei. Es handelt sich dabei um Lagunenkalk, im Unterschied zu den Riffkalken rund um die Goinger Halt. Der Weg läuft kunstvoll dem geschwungenen Gelände entlang und führt zweimal durch gerundete Einschnitte, ehe wir an eine markante Weggabelung herankommen.
4. In den beweideten Almwiesen des Talkessels rund um das Steinberg Haus sind montane Weißklee-Weidelgras-Weiden entwickelt. In Bulten kommen Trollblume, Grauer Alpendost und Großes Zweiblatt vor. Bei der Weggabelung auf 1356 m geht es geradeaus zur Kaindl Hütte, während nach links der Bettlersteig abzweigt. Dieser führt als urtümlicher Weg ins Kaisertal hinab. Wir müssen zunächst noch ein wenig in grasigem Gelände zu einem Sattel aufsteigen, dann stehen wir an der Abbruchkante des Kaisertales, das mit schroffen, legföhrenbewachsenen Hängen in die Tiefe bricht. Dabei sind seilgesicherte Passagen ebenso zu überwinden wie Stellen mit Holztreppen oder Querungen von Gräben und Taleinschnitten. Zweimal bieten Eisenleitern Hilfe, um Steilstufen zu überwinden.
5. Am Einstieg zum Bettlersteig liegt ein abrupter Wechsel von Wiesen- zu Waldgelände vor. Denn während die flachen, westexponierten Hänge oberhalb des Steinberg Hauses zu Weidezwecken gerodet werden konnten, ließen die steilen und schroffen Abbrüche an der Ostseite keinerlei Nutzung zu. Daher treffen wir auf einen montanen Mischwald aus Fichte, Buche und Bergahorn, der bereits deutlich den Einfluss des Alpenvorlandes bzw. das Nachlassen der alpinen Klimabedingungen verdeutlicht. Der Unterwuchs ist uns bereits bekannt, auch wenn die Schneerose nun nicht mehr zu sehen ist. Dafür sind Fluren des Stinkenden Hainsalates entwickelt, eine markante Art der montanen Buchen– Mischwälder. Ochsenauge, Goldrute und Schwarze Akelei haben sich aus den Trockenheit liebenden Fichten- Föhren-Wäldern beigemischt.
Daneben gedeihen noch Gelber Eisenhut, Grauer Alpendost, Seidelbast und Türkenbund. Je weiter wir dem Steig abwärts folgen, umso mehr nehmen die Legföhrenfluren zu, die trockene Kalkfelshänge überziehen. Darin kommt auch die Behaarte Alpenrose vor. Wir steigen durch das schroffe, vielfältige Gelände teilweise steil abwärts, passieren immer wieder kleinere Rinnen und wechseln in einen Kalkbuchenwald. Darin sind Sterndolde, Wald-Flockenblume und Wohlriechender Salomonsiegel enthalten.
Der größte Teil des Abstiegs endet mit der Querung des Straßwalch-Grabens, in den eine Eisenleiter hinab führt und wo später eine Holzbrücke ein Seitengerinne quert.
6. Nach dem Graben wandern wir durch eine Schlagflur, in der reichlich Hasenlattich, Klebriger Salbei, Weiße Pestwurz, Alpen- Milchlattich und Schmalblättriges Weidenröschen wachsen. Aus den Buchenwäldern sind Waldmeister sowie Gemeiner Wurmfarn erhalten geblieben. Anschließend folgt ein fast reiner montaner Buchenwald mit klassischem Unterwuchs aus zahlreichen krautreichen Pflanzen wie Goldnessel, Lungenkraut, Haselwurz, Türkenbund, Gelbem Eisenhut, Quirlblättrigem Salomonsiegel, Vierblättriger Einbeere und Nickendem Perlgras. Dieser Buchen- Bergahorn–Mischwald wächst in Lagen zwischen 600 und 1700 m über Kalk und benötigt im Winter eine intensive Schneebedeckung. Im Sommer ist eine hohe Luft- und Bodenfeuchtigkeit ausschlaggebend, ob dieser Wald aufkommt. Beide Faktoren sind an den unteren Hangbereichen des Wilden Kaisers gegeben.
Nach dem Straßwalchgraben führt der Weg zur Wiesenkuppe mit dem Straßwalchjagdhaus, das einen besonders idyllischen Platz einnimmt.
7. Entlang einer ebenen Passage vor einem weiteren Seitengraben ist eine Hochstaudenflur mit dichten Beständen des Straußfarnes ausgebildet. Der Weg führt durch die mehr als ein Meter hohen Wedel hindurch, daneben kommen Fuchs- Greiskraut, Bärenklau und Wald- Storchschnabel vor.
Nach knapp 3 Stunden Gehzeit senkt sich die Route durch dichten Wald in den Talboden des hinteren Kaisertales und trifft beim Anton-Karg-Haus bzw. Hinterbärenbad (829 m) auf den Talweg. Das Gasthaus steht auf einer kleinen Lichtung, umgeben von Bergahornen. Von hier führt der Weg weiter taleinwärts und erreicht nach 15 Minuten das Hans-Berger-Haus (936 m).
8. Oberhalb des Anton-Karg-Hauses ist ein Bergahorn-Edellaubmischwald ausgebildet, der an den Ufern des Kaiserbaches wächst. Im Unterwuchs finden wir eine dichte Flur an krautigen Arten der Buchenwälder wie Bingelkraut, Gemeinen Wurmfarn, Gelbe Taubnessel, Wald-Ziest, Kleines Zweiblatt, Hasenlattich, Wechselblättriges Milzkraut, Leberblümchen, Breitblättriger Stendelwurz, Wald-Sanikel und Nesselblättrige Glockenblume.
Wir wenden beim Hinterbärenbad talauswärts, doch wandern wir nicht entlang der Fahrstraße. Gleich gegenüber dem Gasthof überquert eine Brücke den Kaiserbach, danach beginnt ein Waldpfad, der durch die Nordhänge zur Hechleit Alm aufsteigt. Nach 20 Minuten queren wir das Bärental.
9. Im Bärental wachsen an den trockenen südexponierten Hängen einige Föhren, in deren Unterwuchs die Astlose Graslilie aufleuchtet.
Vom Bärental steigt der Weg stetig durch bewaldetes Gelände zur Hechleit Alm an (927 m), die wir nach etwas mehr als 30 Minuten ab Hinterbärenbad erreichen. Auf den Almwiesen, die mit Borstgras durchsetzt sind, lassen Bulte der Besenheide noch den ehemaligen Waldstandort erkennen. Dieser wurde früher zuerst beweidet, dann allmählich gerodet und schließlich zu saftigen Almmatten umgebrochen.
10. Von der Alm führt ein bequemer Wirtschaftsweg talauswärts, wobei wir noch eine Zeit aufwärts wandern müssen. Erst ab der Abzweigung des Fahrweges nach Vorderkaiserfelden verlieren wir an Höhe und erreichen später die Böden Alm (938 m). Das Gelände breitet sich als flaches Plateau sehr malerisch vor der Felskulisse des Wilden Kaisers aus, während sich der Bach bereits tiefer in das Tal eingesenkt hat. Teile der Alm sind mit Straußfarnen, Vogelbeere, Mehlbeere und Bergahorn verbuscht. Der Fahrweg mündet knapp vor der Antonius-Kapelle mit dem Hinterkaiserhof in den Talweg zurück.
Wir passieren das landschaftliche Kleinod der Antoniuskapelle, die als Wahrzeichen des Kaisertales auf einem Wiesensattel steht, während im Hintergrund die grauweißen Felsen des Zahmen Kaisers aufragen. Der bequeme Wirtschaftsweg bringt uns von hier in 20 Minuten zum Gasthaus Pfandl. Anschließend folgt der Abstieg über die 150 m hohe Felsstufe. Wir folgen weiterhin dem asphaltierten Weg, bis dieser an einem Parkplatz endet und in den Sparchener Stufenweg übergeht. Zuvor können wir an einem linkerhand die Steilböschung hinabführenden Pfad zur Tischoferhöhle absteigen.
11. Die Tischoferhöhle liegt nur unweit vom Eingang des Kaisertales entfernt. Hier soll ein Riese gehaust haben. Doch in Wirklichkeit konnten die Knochenfunde, die man hier machte, als Reste von Höhlenbären gedeutet werden, die vor 30.000 Jahren gelebt hatten. Man fand auch Speerspitzen, die bereits Menschen zu dieser Zeit vermuten lassen. 4.000 Jahre alt sind die 35 Skelette, die man hier fand. Knochen von Schafen, Schweinen und Ziegenlassen vermuten, dass man schon damals Haustiere hielt. Außerdem soll in der Höhle eine Bronzegießerei betrieben worden sein. Die Tischoferhöhle gilt als bedeutendste Fundstätte urgeschichtlicher Gegenstände in Tirol. Sämtliche Exponate können im Heimatmuseum in der Festung besichtigt werden. Schließlich steigen wir die berüchtigten 200 Treppen durch die westlichen Schanzer Wände ins Tal nach Eichelwang hinab, wo wir auf den Spazierweg nach Kufstein treffen. Wir schwenken nach links ein, queren den Kaiserbach mit Blick auf die enge Klammstrecke und steigen über die Talböschung, vorbei an der Talstation der Materialseilbahn ins Kaisertal, zu den Sparchener Wiesen hinauf. Ein Fahrweg bringt uns in 10 Minuten zum Parkplatz an der Talstation des Kaiserliftes zurück.
GPX-Tracks sind oft ungenau. Die angezeigten Daten können (insbesondere zur Höhe und Steigung) falsch sein.
Auf der Karte lässt sich rechts oben in die Kartengrundlage OpenTopomap umschalten (OpenTopoMap ist nicht immer sofort verfügbar).
Zum Zoomen der Karte bitte STRG und Mausrad benutzen.
Die bildschöne Maria Schwaighofer lebte im 19 Jahrhundert am Pfandlhof, den deshalb besonders viele Berggeher besuchten. Stolz und heiter sei sie gewesen, mit sangesfredigem Mund. Sie verteilte Postkarten, gab Autogrammstunden oder stand Modell. Doch mehr als Erinnerungen konnte kein Verehrer mit nach Hause nehmen, denn geheiratet hat die Moidl nie. Sie verließ ihr Kaisertal nicht, in dem sie 1873 geboren wurde und 1937 verstarb.
Naturführer
Die schönsten Naturwanderungen in Tirol
Entdecken Sie das Natur- und Wanderparadies Tirol!
von Merz, Peter

Karte
Mayr Wanderkarte Nr. 51 "Wilder Kaiser - Going, Ellmau, Scheffau, Söll"

Naturführer
Naturkundlicher Führer Kaisergebirge
von Smettan, Hans

Autor: Text und Fotos: Peter Mertz. Mit freundlicher Genehmigung des Loewenzahn Verlags aus dem Buch "Die schönsten Naturwanderungen in Tirol"
Openstreetmap Darstellung von J.Dankoweit
Openstreetmap Darstellung von J.Dankoweit